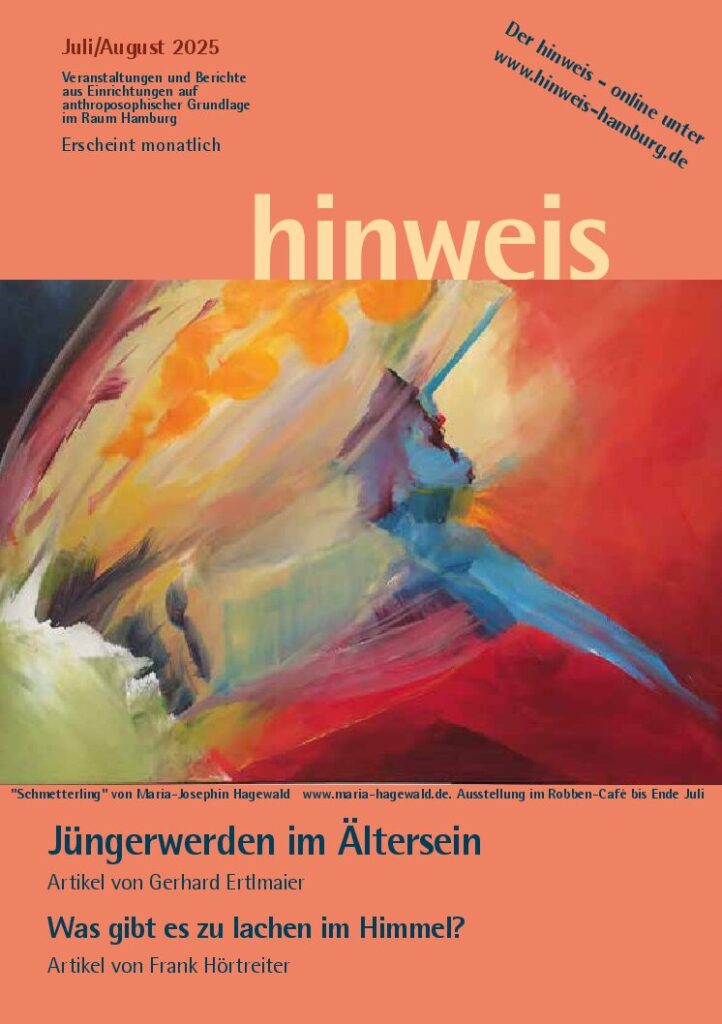Willkommen auf der Seite für Adressen, Veranstaltungen und Berichte aus Einrichtungen auf anthroposophischer Grundlage im Raum Hamburg
Über die Evolution des Menschen und der Tiere
Interview mit Prof. Dr. Christoph Hueck, Biologe

Nach Darwin ist der Mensch das Zufallsprodukt eines blinden Naturprozesses. Nach der christlichen Tradition wurde er von Gott geschaffen und hat eine Sonderstellung in der Natur, weil er das einzige Wesen ist, das Gut und Böse, Wahrheit und Irrtum bewusst unterscheiden und danach handeln kann. Rudolf Steiner entwickelte durch Goethes Metamorphosenlehre eine Synthese, in der Darwins Sicht einen höheren, geistigen Sinn und der christliche Glaube eine empirische Faktenbasis erhält.
Christoph Hueck studierte Biologie und Chemie, promovierte im Fach Genetik, forschte in Deutschland und den USA. Tätigkeiten als Waldorflehrer, Dozent für Waldorfpädagogik und anthroposophische Meditation, Redakteur der Zeitschrift „Die Drei“ und Mitbegründer der Akanthos-Akademie für anthroposophische Forschung und Entwicklung in Stuttgart.
www.metamorphose-mensch-tier.de
Vom 16.2. – 31.3 wird im Rudolf Steiner Haus eine Ausstellung „Metamorphose Mensch & Tier“ zu sehen sein. Prof. Dr. Christoph Hueck hält begleitende Seminar und Vorträge, siehe Ende des Interviews und im Terminteil.
Christine Pflug: Was ist der Abstammungsgedanke von Darwin? Wie ist nach ihm das Lebendige überhaupt entstanden?
Prof. Dr. Chrisoph Hueck: Kurz gesagt bedeutet Darwins Abstammungsgedanke, dass alle Menschen, Tiere, Pflanzen, Pilze und Bakterien miteinander verwandt sind und ihre verschiedenen Arten sich auseinander entwickelt haben. Alle einzelnen Organismen, die jetzt leben oder jemals gelebt haben, sind wie Blätter an einem gemeinsamen, riesigen Baum des Lebens, der aber nicht räumlich, sondern zeitlich zu denken ist. Ein Strom der gemeinsamen Abstammung geht sozusagen durch uns alle hindurch. Dieser Gedanke ist großartig. Darwin hat damit die alte Auffassung verworfen, dass ein jenseitiger Gott die verschiedenen Arten und Gattungen einzeln und nebeneinander geschaffen hätte. Darwin hat unsere Vorstellungen über das Lebendige selbst verlebendigt, indem er die zeitliche Dimension in das biologische Denken eingeführt hat. Er war sich allerdings bewusst, dass er über den Ursprung des Lebens selbst nichts aussagen kann (dafür nahm er noch einen einmaligen göttlichen Schöpfungsakt an). Heute kann die Naturwissenschaft die Entstehung des Lebens immer noch nicht erklären (obwohl in der Presse gern anderes behauptet wird). Allerdings weiß Darwin nicht, warum alles so geworden ist, wie es ist. Hier musste er den Zufall und den sogenannten Kampf ums Dasein zu Hilfe nehmen.
C. P.: Wie ist nach der christlichen Tradition der Mensch entstanden?
C. H.: Die christlichen Kirchen tun sich mit dem Darwinismus, aber auch mit der biblischen Schöpfungslehre schwer. Die Welt ist sicher nicht in sieben Tagen entstanden. Die Fakten zeigen, dass sich das Leben auf der Erde in unvorstellbar langen Zeiträumen entwickelt hat. Diese Entwicklung ist durch Fossilien sehr gut dokumentiert, wie man zum Beispiel in der schönen paläontologischen Sammlung der Universität Hamburg sehen kann. Andererseits lebt in der christlichen Tradition ein Bewusstsein von der Sonderstellung des Menschen in der Natur, von seiner Gott-Ähnlichkeit, denn er ist eben das einzige Wesen, das Gut und Böse, Wahrheit und Irrtum bewusst unterscheiden und danach handeln kann. Man kann sagen: Das, was als ein göttlicher oder geistiger Funke im Menschen lebt, was nur von innen heraus in ihm strahlt und wärmt, und was ihn eben von den Tieren unterscheidet, das haben die Kirchen in gewisser Weise noch im Blick. Für sie ist der Mensch, ist das Leben auf der Erde von Sinn getragen. Aber sie haben keine Methode, um dieses Geistige mit den naturwissenschaftlichen Tatsachen in Einklang zu bringen.
Die christliche Auffassung von der geistigen Sonderstellung des Menschen mit dem Darwinismus in einer neuen Synthese verbunden
C. P.: Rudolf Steiner hat, angeregt durch Goethe, einen dritten Weg dargestellt. Wie ist der zu verstehen? Wie sind da die methodischen Schritte? Wie steht er zu den beiden vorigen Thesen?
C. H.: Nun, Goethe hat diese eben erwähnte Methode einer ganzheitlichen Naturbetrachtung entwickelt. Er war ja auch ein genialer Naturforscher, der sich mit Pflanzen- und Tierkunde, mit Mineralogie, Meteorologie, Farbenlehre u.a.m. beschäftigt hat. Rudolf Steiner hat Goethes methodische Leistung schon als junger Mann erkannt und als Herausgeber von Goethes naturwissenschaftlichen Schriften ausführlich beschrieben und philosophisch begründet, und er hat sie später auch weiter entwickelt. Es ist eine Methode, die einerseits streng phänomenologisch vorgeht, das heißt, dass Erklärungen der Natur auf Erfahrungen, nicht auf Theorien beruhen müssen. Dann hat Goethe bemerkt, dass man verwandte Naturphänomene sammeln und miteinander vergleichen muss, wenn man zu anschaulichen – und nicht bloß zu theoretischen – Erklärungen kommen möchte. Zum Beispiel kann man nur durch den Vergleich von verschiedenen Pflanzen- oder Skelettformen das ihnen Gemeinsame als Anschauung finden. Diese Art der Anschauung nannte man in der deutschen idealistischen Philosophie, z.B. bei Kant, bei Fichte oder Schelling die „intellektuelle Anschauung“. Goethe sagte, dass er seine „Ideen wie mit Augen sehen“ könne, und dass man auch mit diesen „Geistesaugen“ sehen müsse, weil man sonst Gefahr laufe, „zu sehen, und doch vorbei zu sehen“. Er suchte überall ein Inneres, Geistiges, das den äußeren Erscheinungen zugrunde liegt. In der Ausstellung „Metamorphose Mensch & Tier“ kann man diese Methode kennen lernen und selbst erleben, wozu sie führen kann. – Und damit ist man schon fast bei der Anschauung des inneren, geistigen Funkens im Menschen, von dem ich oben gesprochen habe. Man muss nur Goethes Methode auch noch auf die inneren, seelischen Phänomene anwenden. Man sieht dann – und auch das wird in der Ausstellung gezeigt –, wie die äußeren biologischen Formen des Menschen und der Tiere mit den inneren, seelischen und geistigen Phänomenen korrespondieren. Alles bekommt einen neuen Sinn, aber nicht durch einen religiösen Glaubensakt oder durch „esoterische Spinnerei“, sondern durch ganz pragmatische Anschauung. Man kann also sagen, dass Rudolf Steiner die christliche Auffassung von der geistigen Sonderstellung des Menschen mit dem Darwinismus in einer neuen Synthese verbunden hat, wodurch die Einseitigkeiten beider Auffassungen überwunden werden. Der Darwinismus bekommt einen höheren, geistigen Sinn und der christliche Glaube eine empirische Faktenbasis. Das ist natürlich vereinfacht gesagt, aber es trifft im Kern zu.
C. P.: Wie ist der Mensch, wie sind die Tiere entstanden im Sinne von Steiner? Was bedeutet die Aufrichte (beim Menschen)?
C. H.: Der bekannte amerikanische Philosoph Thomas Nagel hat in einem sehr lesenswerten Buch (Geist und Kosmos, 2013) dargestellt, dass der Darwinismus nicht erklären kann, wie das Leben, das Bewusstsein und wie moralische Werte aus toter Materie entstanden sind. Er fordert eine grundlegend neue Theorie, die das Bewusstsein ins Zentrum der Evolutionslehre stellt. Nach Rudolf Steiner ist nicht das Bewusstsein die innere Triebfeder der Evolution, sondern das, was er Geist nennt, also eine gesetzmäßig wirkende Kraft, die zwar dem Leben und dem Bewusstsein zugrunde liegt, die aber die ganze Welt durchzieht und aus der die Welt hervorgegangen ist. Ein Teil von dieser Kraft ist als der oben genannten „Funke“ in jedem Menschen lebendig.
Das Bewusstsein, das Leben und sogar die Materie haben sich durch sukzessive „Verdichtungen“ aus dem Geistigen entwickelt.
Nach Steiner haben sich das Bewusstsein, das Leben und sogar die Materie durch sukzessive „Verdichtungen“ aus dem Geistigen entwickelt. Das ist natürlich ein ungeheurer Gedanke, mit dem Steiner aber in der Tradition der griechischen, der mittelalterlichen und auch der neueren idealistischen Philosophie steht, und der auch ausführlich begründet werden kann. Der Mensch ist nun nach Steiner von Anfang der Weltentwicklung an in geistiger Form vorhanden gewesen, und aus seinem Wesen sind die Tiere – in der Reihenfolge, wie wir sie in den geologischen Schichten finden – nach und nach hervorgegangen. Nach Steiner sind die Tiere Absonderungen aus dem geistigen Menschenwesen, sie stammen in Wahrheit von ihm ab, nicht er von ihnen. Physisch gesehen ist der menschliche Organismus allerdings dann aus dem tierischen hervorgegangen. Die Entstehung des Menschen war also nicht ein zufälliger Prozess, wie Darwin annahm, sondern eine sinnvolle Metamorphose der biologischen Evolution, so, wie die Blüte eine „sinnvolle“ Metamorphose der Pflanzenentwicklung ist. Dieser Gedanke begründet auf eine neue Art unsere innere, geistig-seelische Verwandtschaft mit den Tieren und auch unsere Verantwortung für sie. – Die Aufrichtung des Menschen zeigt seine autonome innere Kraft, eben den genannten geistigen Funken. Keine äußeren Ursachen bringen den Menschen dazu, auf zwei Beinen zu laufen, und das kommt auch nicht aus der Vererbung, sondern muss von jedem Kind individuell erarbeitet werden. Aus diesem Grund tut sich der Darwinismus mit der Aufrichtekraft des Menschen außerordentlich schwer.
Die Gliedmaßen der Tiere können geistig von denen des Menschen abgeleitet werden, nicht umgekehrt
C. P.: Wie kann man Steiners Gedanken an einem Beispiel erläutern?
C. H.: Die Ausstellung zeigt das unter anderem an einem Vergleich der menschlichen und tierischen Gliedmaßen. Die Flügel eines Vogels oder einer Fledermaus, die Beine eines Pferdes, die Flossen eines Seehundes, die Grabhand eines Maulwurfs, die Tatzen eines Löwen usw. sind alle nach ein- und demselben Grundmuster gebaut, aber jeweils als Werkzeuge für bestimmte Fortbewegungsweisen hoch spezialisiert. Zeichnet man das allgemeine Grundmuster auf (ein Knochen des Oberarms, zwei des Unterarms, drei und dann vier in der Handwurzel, fünf Mittelhand- und Fingerknochen), so sieht man, dass der Arm und die Hand des Menschen genau diesem Grundmuster entsprechen. Der Mensch verkörpert hier sozusagen die allgemeine Idee. Die Gliedmaßen der Tiere können geistig von denen des Menschen abgeleitet werden, nicht umgekehrt. Der menschliche Arm und die Hand sind nicht spezialisiert, sondern einfach gebaut, und gerade dadurch können wir so viele verschiedene Tätigkeiten mit ihnen ausführen. Die Tiere sind in dieser Beziehung also eigentlich weiter entwickelt als der Mensch, während der Mensch die Urform verkörpert. Im Sinne des Prologs des Johannesevangeliums kann man sagen: In der menschlichen Gestalt ist das Wort, aus dem alles andere hervorgegangen ist, „Fleisch“ geworden. – Diesen Gedanken findet man übrigens außer bei Steiner auch noch bei etlichen anderen Denkern und Forschern. Darwin hat die Ähnlichkeit der Gliedmaßen durch die gemeinsame Abstammung erklärt und ihre Verschiedenheit durch Anpassung an äußere Lebensbedingungen, aber er hat nicht gesehen, dass im Menschen das allgemeine Grundmuster erscheint. Darwin hat sozusagen den Menschen übersehen. Er war aber ja selber ein Mensch, und nur als solcher konnte er die Evolution überhaupt erkennen. Man muss also den Menschen und sein Erkennen unbedingt mit berücksichtigen, wenn man eine tragfähige Evolutionslehre haben will. Das hat im Grunde auch Thomas Nagel gefordert. Das Besondere der Anthroposophie Rudolf Steiners ist, dass eben der Mensch immer mit berücksichtigt wird.
C. P.: Und eine etwas ketzerische Frage: Wenn der Mensch als Ziel der Evolution angesehen wird – wie ist das auf einer moralischen Ebene zu verstehen? Nehmen wir uns als Menschen nicht sowieso zu wichtig?
C. H.: Nach Steiner sind die Tiere aus dem geistigen Menschenwesen hervorgegangen, sozusagen abgesondert worden. Das hat aber erst die physische Menschwerdung ermöglicht. Ohne die Tiere gäbe es uns nicht hier auf der Erde. Wie ohne Stängel und Blätter die Blüte nicht möglich wäre, so der Mensch nicht ohne die Tiere. Wir verdanken ihnen unser physisches Dasein. Im Sinne Rudolf Steiners kann man die ganze Stammesgeschichte der Tiere als „Menschwerdung“ bezeichnen. Jede Tierart verkörpert in einseitiger Art etwas von dem, was im Menschen in harmonischer Ausbildung vereint ist. Die Tiere gehören also zu uns, sie sind Teile von uns, und wir sollten sie dementsprechend demütig und mitfühlend behandeln. Es macht einen großen Unterschied, ob man Tiere in materialistischer Art als Zufallsprodukte der Evolution ansieht oder – in geistigem Sinne – als Abkömmlinge von uns. Das heißt aber nicht, den Unterschied zwischen Mensch und Tieren zu verwischen. Viele Tierarten sind intelligent, kreativ und sogar empathisch, aber kein Tier kann sich vornehmen, morgen anders zu handeln als heute. Das kann nur der Mensch. Wir können – und müssen – Verantwortung für die Tiere übernehmen, nicht sie für uns.