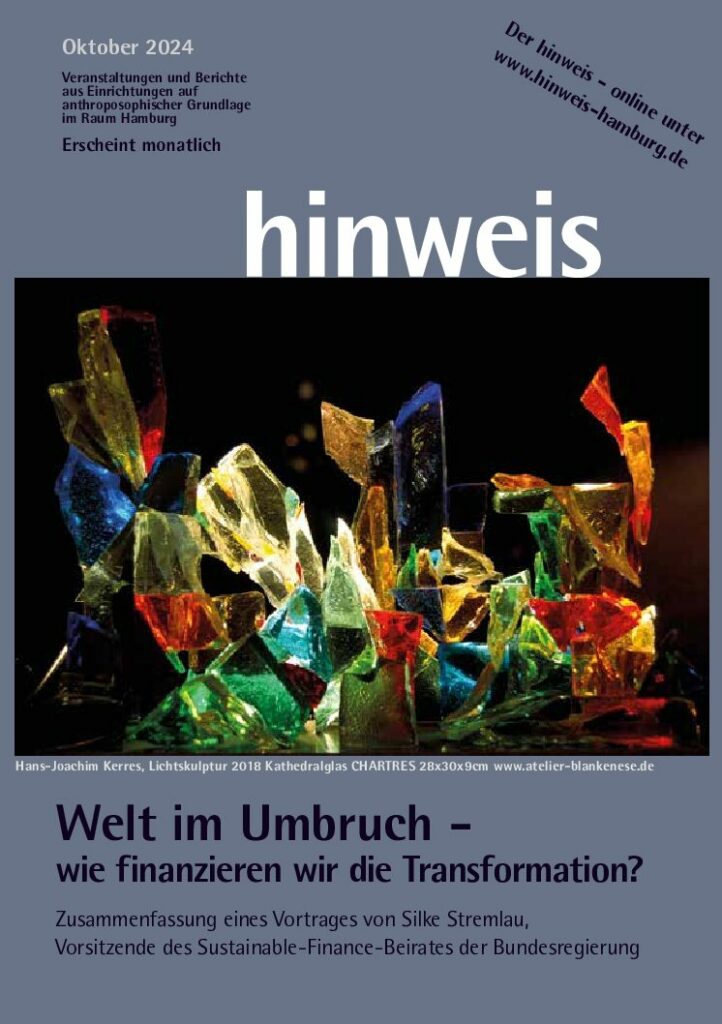Willkommen auf der Seite für Adressen, Veranstaltungen und Berichte aus Einrichtungen auf anthroposophischer Grundlage im Raum Hamburg
Kein Lob und Tadel!?
Interview mit Roswitha Willmann und Annette Willand, Elternberatung


Nicht nur unter Eltern, sondern auch unter (Waldorf-) Pädagogen gehören Lob und Tadel zum täglichen Umgang mit den Kindern: „So ist es prima!“, „Das hast du fein gemacht!“, „Du bist ja eine ganz Gescheite!“ einerseits, andererseits „Du weißt doch, dass man nicht haut!, „Kannst du nicht mal stillsitzen!?“, „Du bist doch schon so groß, da solltest du das aber besser können!“. Nützen Tadel nichts – gibt es Konsequenzen wie „Auszeiten“, Fernseh-verbot o.ä., die zum gewünschten Erfolg … führen? Führen sollen?
Am Bernard Lievegoed Institut in Hamburg werden seit 25 Jahren Kinder betrachtet, Eltern beraten und Pädagogen weitergebildet. Roswitha Willmann und Annette Willand arbeiten mit ihnen daran, auf Lob und Tadel zu verzichten und stattdessen mit dem Kind zu kooperieren.
Interviewpartnerinnen: Roswitha Willmann, Gymnastiklehrerin, Rhythmische Masseurin, Mediatorin. Langjährige Tätigkeit in der Heilpädagogik, Schwerpunkt Autismus. Weiterbildungen in Sensorischer Integration, Beziehungslernen und Beziehungstherapie. Im Bernard Lievegoed Institut: Entwicklungsdiagnostik und -beratung für Schulkinder, Kindertherapie, Einzel- und Paarberatung, Lerntherapie, Rhythmische Massage (Erwachsene und Kinder), Mediation, Seminartätigkeit.
Annette Willand, Diplompsychologin, Heilpraktikerin Psychotherapie, Mitglied im Bund deutscher Psychologen (BDP) Psychotherapieausbildung, Kursleitung in Elternschulen, Tätigkeit in der psychologischen Forschung, Weiterbildungen in psychologischer Diagnostik, Entwicklungsdiagnostik, Sonderpädagogik, Floortime™ und Bindungspsychologie. Im Bernard Lievegoed Institut: Entwicklungsdiagnostik und -beratung für Babies, Klein- und Kindergartenkinder, Kindertherapie, Psychologische Diagnostik und Gutachten, Seminartätigkeit.
Das Interview führte Franziska Wolffheim
Franziska Wolffheim: In Ihrer Arbeit mit Eltern und deren Kindern versuchen Sie, ohne Lob und Tadel auszukommen. Die meisten von uns sind allerdings mit diesem Prinzip groß geworden. Was ist an Lob und Tadel eigentlich so schlimm?
Annette Willand: Auf der Ebene von Lob und Tadel richten wir als Eltern oder Pädagogen unseren Blick auf das Verhalten des Kindes, beurteilen und kommentieren dieses. Dabei verlieren wir aus dem Blick, welche Bedürfnisse und Gefühle, eventuell auch Nöte hinter dem Verhalten stehen.
Lob und Tadel sind eine Form von Manipulation
Lob und Tadel sind eine Form von Manipulation: Ich versuche, das Kind durch „Leckerlis“ oder Strafen (Tadel, „Konsequenzen“) zu einem bestimmten Verhalten zu bringen. Dadurch wird meine Beziehung zum Kind und das Kind verletzt: Zum einen, weil wir dem Kind das Vertrauen entziehen, dass es kooperieren möchte. Zum anderen, weil wir das, was es – ebenso wie Nahrung – zum Gedeihen braucht, an Bedingungen knüpfen: unsere Liebe, unser Interesse, unser Mitgefühl.
Es wird, nein muss, sein Verhalten nach diesen durch Lob und Tadel definierten Bedingungen ausrichten. Und es wird immer abhängiger von unseren Beurteilungen. Das führt im Übrigen auch dazu, dass solche Kinder diesen Rahmen von Lob und Tadel dann immer mehr brauchen; sind die lobenden und tadelnden Erwachsenen einmal nicht dabei, zeigen sie das erwünschte Verhalten dann oft nicht mehr. Kinder lernen Wohlverhalten eben dadurch, dass wir uns ihnen und anderen gegenüber wohl verhalten und nicht dadurch, dass wir versuchen, sie zu dressieren.
Roswitha Willmann: … und dadurch, dass sich das Kind immer mehr am Außen orientiert, leidet auch die Beziehung des Kindes zu sich selbst, besonders dann, wenn seine Gefühle und Bedürfnisse nicht ernst genommen werden. Es nimmt diese dann im Laufe der Zeit selbst nicht mehr ernst. Das sind dann später die Erwachsenen die durch mangelnde Selbstfürsorge später zu Burnouts neigen.
Das Kind hat kein inneres Gefühl mehr dafür, was es gut kann
Aber auch Selbstwert und Selbsteinschätzung leiden: Häufig kommen Eltern zu uns in die Beratung mit der Frage, was sie dazu beitragen können, dass ihr Kind selbstbewusster wird. Auf Nachfrage erzählen sie, dass ihr Kind oft fragt: „Habe ich das schön gemacht?“ Die Kinder freuen sich natürlich, wenn sie von ihren Eltern dann ein Lob bekommen. Die Frage der Kinder kommt aus einer Unsicherheit: Wie habe ich die Aufgabe ausgeführt? Das Kind hat kein inneres Gefühl dafür, wie es eine Aufgabe gemacht hat, was es gut kann, wo es noch üben muss und was es braucht. Ein Lob ist für den Moment gut, bringt die Augen der Kinder zum Strahlen. Es hat aber keine Nachhaltigkeit, weil die Kinder zwar jetzt wissen, dass die Eltern es schön finden, aber nicht ob sie selbst damit zufrieden sind. Dieser eigene innere Maßstab, Selbstbewusstsein, bzw. die Möglichkeit der Selbsteinschätzung von „Habe ich etwas gut oder nicht so gut gemacht“ fehlt ihnen später, wenn sie als Erwachsene aus sich heraus ihre Fähigkeiten beurteilen sollen. Auch als Erwachsenen richten sie sich dann immer noch an den Beurteilungen anderer aus.
A. Willand: Ein weiterer Aspekt ist, dass die Kinder ihre natürliche Neugierde, ihr Interesse und die Freude an dem, was sie tun, verlieren, wenn ihre Motivation nur von außen kommt, sie die Dinge tun, um ein Lob oder eine Belohnung zu bekommen. Für ein kleines Kind ist zum Beispiel ganz selbstverständlich, Klötzchen aufeinander zu stapeln: Es ist ganz vertieft in sein Tun, es forscht und es denkt im Handeln, und es ist glücklich dabei. Wenn wir nun den hohen Turm loben, nicht aber die Begeisterung des Kindes mitfühlen und spiegeln, baut das Kind eventuell die nächsten Türme, um wieder dieses Lob zu empfangen. Die Freude am Turmbau selbst hingegen nimmt ab, das Kind verbindet sich nicht mehr so damit. Das Gleiche gilt später für Referate oder andere Aufgaben in der Schule: Freude und Interesse und auch die Leistungen werden geringer, wenn Aufgaben vor allem für eine gute Note gemacht werden. In der Erziehungswissenschaft ist das mittlerweile bekannt, zu Kindergärten, Schulen und Elternhäusern aber leider noch nicht wirklich durchgedrungen.
Die Ressourcen des Kindes einbinden
Franziska Wolffheim: Wenn Lob und Tadel also schädlich sind: Was sollen Eltern und Erzieher tun, um zum Beispiel ein Kind zu motivieren zum Lernen für einen Vokabeltest?
R. Willmann: Ich sage den Eltern, dass sie zusammen mit dem Kind über die einzelnen Aufgaben und Lernprozesse reflektieren sollen – vorausgesetzt, die Kinder sind schon etwas älter. Zum Beispiel der Test ist nicht so gut ausgefallen, dann kann man mit dem Kind auf die Suche gehen: „Bist du zufrieden mit dem Ergebnis?“ „Was möchtest du beim nächsten Mal für ein Ergebnis erzielen?“ „Was glaubst du, woran es liegt, dass er so ausgefallen ist?“ „Was hast du für den Englisch-Vokabeltest getan, wie oft hast du gelernt? War das Üben anstrengend und warum? Möchtest du, dass ich dich unterstützte, wenn ja wie?“ Man versucht also, die Ressourcen des Kindes einzubinden.
Franziska Wolffheim: Wenn ich mit meinem Kind zusammen die Vokabeln durchgehe, und die Arbeit läuft gut: Wie kann ich ihm zu verstehen geben, dass ich seine Leistung anerkenne, ohne es zu loben?
A. Willand: Ich kann beschreiben, was ich sehe, wieviel schon gelernt ist. Ich kann die Gefühle des Kindes versuchen zu spiegeln, z.B. indem ich mich mitfreue darüber, wie gut es für das Kind läuft oder die Erleichterung mit ihm teile, dass nun nicht mehr viel zu lernen ist.
Franziska Wolffheim: Ich kann aber auch Ich-Botschaften formulieren, z.B. indem ich sage, dass ich darüber staune, wie schnell es die Vokabeln gelernt hat.
Wichtig ist, dass es dem Kind beim Lernen gut geht
R. Willmann: Wichtig ist, dass es dem Kind beim Lernen gut geht, dass es ausgeruht ist und genug Bewegung hatte, zum Beispiel. Und wenn es mal nicht optimal läuft, sollten Eltern sich interessieren, warum das so ist und zum Beispiel konkret nachfragen: „Geht es dir heute nicht so gut, wollen wir mal eine Pause machen?“ „Was brauchst du, damit du weitermachen kannst?“
Franziska Wolffheim: In den herkömmlichen Schulen wird permanent mit Lob und Tadel gearbeitet. Wenn Eltern zu Hause versuchen, anders mit ihren Kindern umzugehen, stoßen zwei Erziehungsprinzipien aufeinander.
A. Willand: Das ist in der Tat schwierig. Ich glaube aber, dass Kinder, die mit wenig Lob und Tadel groß werden, ein gutes Fundament haben, um die Unterschiede zwischen Schule und Elternhaus zu verkraften. Problematisch wird es, wenn Eltern das schulische System von Lob und Tadel übernehmen. Dann haben die Kinder nie eine Entspannung.
R. Willmann: Kinder brauchen zum Gedeihen bedingungslose Liebe und das starke Gefühl, ich bin ok so wie ich bin. Ich denke, dass diese Liebe eine so große Stabilität gibt, dass die Kinder die Kraft haben, das andere System auszuhalten.
wenn der Lehrer wieder so streng war …
Franziska Wolffheim: Wie sollen Eltern reagieren, wenn das Kind nach Hause kommt und sich beklagt, dass der Lehrer wieder so streng war und es getadelt hat?
R. Willmann: Erst mal steht das Kind mit seinen Gefühlen im Mittelpunkt, denn Gefühle sind immer richtig und ernst zu nehmen. Dann Nachfragen, zuhören, Anteilnahme zeigen. Sich die Situation vom Kind schildern lassen und welche Rolle es selbst dabei gespielt hat. Im letzten Schritt kann man gemeinsam überlegen, was das Kind von mir braucht, um mit dem Verhalten des Lehrers besser klar zu kommen. Findet man erstmal keine Lösung, dann sollten die Eltern das Gespräch mit dem Lehrer suchen.
Franziska Wolffheim: Was kann ich als Mutter oder Vater tun, wenn mein Kind im Unterricht permanent hinein plappert?
A. Willand: Hm, grundsätzlich natürlich wenig, denn im Unterricht sind sie ja nicht dabei. Der Unterricht liegt im Verantwortungsbereich der Schule.
Franziska Wolffheim: Aber auch hier ist es gut herauszufinden, warum mein Kind das macht, anstatt es zu beschuldigen. Es kann tausend Gründe dafür geben. Und meist können die Kinder einfach nicht anders, sie sind eben noch keine Erwachsenen und können ihre Schwächen noch nicht so gut kompensieren.
ein Codewort für die Situationen überlegen
R. Willmann: Damit der Lehrer nicht immer sagen muss: „Paul sei still“, was für Paul ja auch nicht schön ist, weil er ja nicht immer merkt, wenn er redet, kann es sinnvoll sein, wenn sich Lehrer und Schüler zusammensetzen und ein Codewort für Situationen überlegen, in denen das Kind stört – zum Beispiel „Kuckucksuhr“ oder „Krokodil“. Alternativ könnte das Signal ein deutliches Augenzwinkern sein. Das schützt das Kind auch davor bei den Mitschülern immer der zu sein, der ermahnt werden muss. Auch für zu Hause sind solche Gesten und Wörter hilfreich.
Wie kann ich ein Kind motivieren, das gerade ständig schlechte Noten schreibt?
R. Willmann: Bei den älteren Kindern, mit denen ich arbeite, frage ich dann zum Beispiel nach: Was möchtest du später einmal machen, wo willst du hin? Fernziele – wenn der Jugendliche zum Beispiel Flugzeugkapitän werden möchte – können eine Motivation sein, um in der Schule wieder durchzustarten.
Franziska Wolffheim: In welcher Situation fällt es Eltern besonders schwer, auf Lob und Tadel zu verzichten?
A. Willand: Das passiert, wenn sie das Verhalten ihres Kindes moralisch nicht in Ordnung finden, weil es zum Beispiel ein anderes Kind ohne für uns ersichtlichen Grund haut. Wird die Situation von anderen Eltern beobachtet, wächst natürlich nochmal der Druck, das eigene Kind zu tadeln. Hinderlich können auch feste Vorstellungen sein, wie ich möchte, dass mein Kind ist oder werden soll; dann steigt der Druck, es mit Lob und Tadel in die eine oder andere Richtung zu beeinflussen.
Welche Rolle spielt Stress, unter dem Eltern stehen?
A. Willand: Stress wirkt sich natürlich ebenso ungünstig aus. Ich bin dann als Mutter oder Vater ungeduldiger und neige eher dazu, mein Kind zu kritisieren oder mit ihm zu schimpfen, auch wenn ich das eigentlich gar nicht möchte.
Ist es für die Eltern eine Überforderung?
Franziska Wolffheim: Kann es für Eltern, die meist selbst mit Lob und Tadel groß geworden sind, auch eine Überforderung sein, wenn sie gar nicht mehr loben und tadeln dürfen?
R. Willmann: Klar. Eltern müssen ihre Gewohnheiten ändern, und das ist verdammt schwer. Ich sage ihnen immer, dass es schon gut ist, wenn sie es in einer Situation am Tag schaffen, sich anders zu verhalten. Für viele Eltern ist es auch eine Motivation, sich klar zu machen, dass sie doch eigentlich freie Geister erziehen wollen, die eine eigene Meinung haben und nicht dem nachrennen, der am lautesten brüllt.
A. Willand: Ich erlebe immer wieder Eltern, die furchtbar angestrengt vom Alltag mit ihren Kindern und dem ständigen – nutzlosen – Loben, Tadeln und Konsequenzen ziehen sind. Eltern, die traurig sind, ihre Liebe nicht mehr wirklich zu empfinden. Diese Eltern sind dann oft unendlich erleichtert und glücklich, wenn sie jenseits von Lob und Tadel wieder in Kontakt mit ihren Kindern kommen, indem sie sich deren Gefühlen und Bedürfnissen zuwenden und einfach mit ihnen mitfühlen. Solche Momente sind ein unglaublich kostbarer Schatz für Eltern und Kinder. Und ich habe nicht selten erlebt, dass dieser Ebenenwechsel in der Interaktion – von der Verhaltensebene auf die Gefühls- und Bedürfnisebene – zu deutlichen (positiven!) Verhaltensänderungen seitens der Kinder geführt hat. Dieser Ebenenwechsel und der Kontakt gelingen nicht immer, aber es lohnt sich, damit anzufangen!