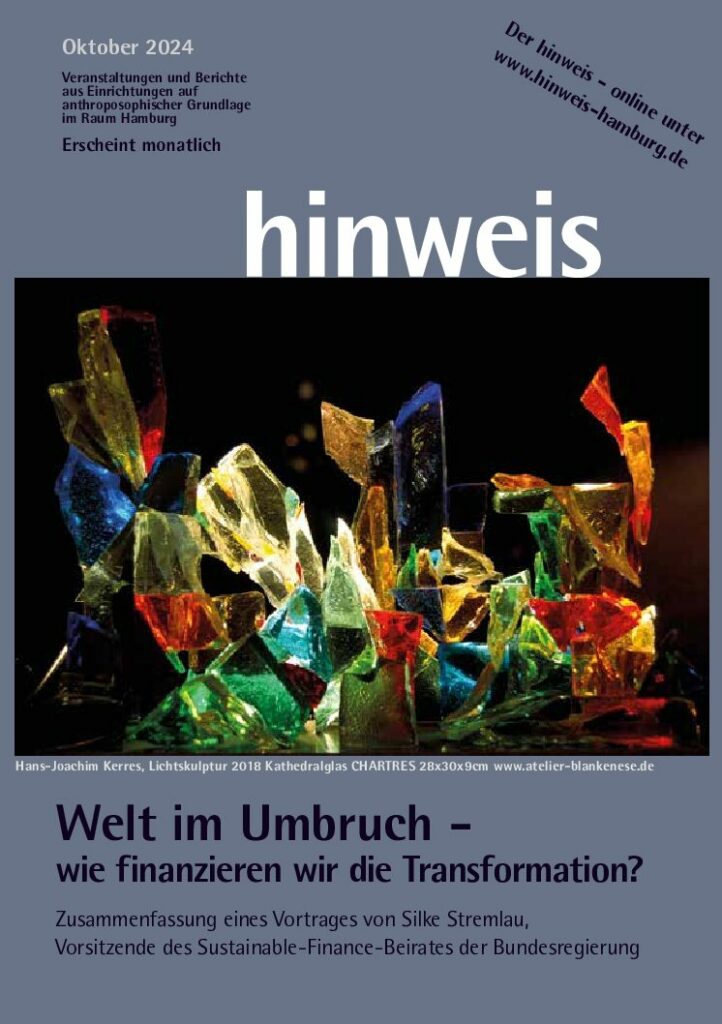Willkommen auf der Seite für Adressen, Veranstaltungen und Berichte aus Einrichtungen auf anthroposophischer Grundlage im Raum Hamburg
Im Township in Südafrika
Interview mit dem Freiwilligenhelfer Martin Anael Heppner

Die Kultur der Schwarzen mit viel Musik und Tanz, riesige Gruppen von kleinen afrikanischen Kindern in einem Kindergarten, Raubüberfälle und vieles mehr hat der junge Mann Martin Anael Heppner in seinem freiwilligen sozialen Jahr im Township Khayelitsha erlebt. „In der Schule hatte ich über das Leben gelernt, aber mit dem Leben umgehen – das habe ich in Afrika gelernt.“ So ist sein Resumée nach 14 Monaten.
Interviewpartner: Martin Anael Heppner, 21 Jahre alt, hatte in 2010 das Gymnasium mit der 12. Klasse verlassen; die ersten 4 Jahre seiner Schulzeit war er in einer Rudolf Steiner Schule. Über die „Freunde der Erziehungskunst“ (Projektmanagement für Waldorfpädagogik im Ausland) ging er für ein freiwilliges Soziales Jahr nach Südafrika in das „Centre for Creative Education“ im Township Khayelitsha in der Nähe von Kapstadt. Dort arbeitete er als Hilfskraft in einem Kindergarten.
Christine Pflug: Wie kamst du auf die Idee, nach Südafrika zu gehen?
M. A. Heppner: Ich hatte in der 12. Klasse die Schule abgebrochen, und dann dachte ich mir: „Wenn du jetzt nicht etwas machst, fällst du in ein Loch“. Afrika wollte ich schon immer sehen, und so bewarb ich mich bei den „Freunden der Erziehungskunst“ für ein Freiwilliges Soziales Jahr. Es gab eine einzige Stelle, die habe ich gleich genommen, und innerhalb eines Monats war dann alles organisiert.
es ist das drittgrößte Township Südafrikas
C. P.: Was für eine Stelle war das?
M. A. Heppner: Das war ein Kindergarten im „Centre for Creative Education“. Das liegt im Township Khayelitsha, was in der IsiXhosa-Sprache „neue Heimat“ heißt; es ist das drittgrößte Township Südafrikas. Es besteht vor allem aus Hütten aus Blech, Holz und Pappe. Im Township wird fast nur Xhosa gesprochen, das ist eine afrikanische Klicklaut-Sprache.
Eine ehemalige Deutsche hatte dort eine Schule und 10 Kindergärten gegründet. Sie hat die „Mamas“ – so heißen dort die Erzieherinnen – ausgebildet und ihnen Waldorfpädagogik vermittelt.
Khayelitsha hat eine Größe von 3 x 10 km, es leben dort aber 2 Millionen Einwohner. In Hamburg wohnen ungefähr auch so viele Menschen, aber die Fläche beträgt 755 Quadratkilometer. Und es gibt keine zweistöckigen Häuser in Khayelitsha. Da ist also immer was los!
C. P.: Sind in dem Kindergarten nur schwarze Kinder?
M. A. Heppner: Im Township leben nur Schwarze. Wir in Europa unterscheiden nicht zwischen Schwarzen und Farbigen, die Afrikaner aber sehr wohl. Die mögen sich gegenseitig nicht immer! Die Farbigen, also die Mischlinge, werden von den Weißen etwas besser behandelt und wohnen in kleineren Steinhäusern. Man kann die Unterschiede auch am Verdienst sehen: Ein Schwarzer verdient 60 – 150 Euro im Monat, ein Farbiger etwa hundert Euro mehr und ein Weißer etwa 600 – 2.000 Euro.
sie beginnen zu tanzen – sie können gar nicht anders
C. P.: Was waren deine Aufgaben in dem Kindergarten?
M. A. Heppner: Ich habe die „Mamas“, wie die Erzieherinnen genannt werden, unterstützt. Man sagt dort zu allen älteren Frauen „Mama“, das ist eine Art Respekterweisung.
Wenn man als Weißer in ein Township kommt, schauen einen die Kinder mit großen Augen an – sie haben oft noch keine Weißen gesehen, weil sie aus dem Township kaum rauskommen. Sie wollen die Haare und die Haut anfassen und lieben es, wenn man ihnen etwas beibringt. Es sind ja eine Menge Kinder, manchmal 50 in einer Gruppe und nur eine Mama, die sie beaufsichtigt.
Sie haben im Allgemeinen ihren festen Tagesablauf, mit Spielen, Lernen, Tanzspielen usw. Ich habe mit Ihnen Sport gemacht, habe ihnen ein wenig schreiben beigebracht. Vor allem lieben sie es zu tanzen. Wenn man ein Lied spielt, stehen sie auf und beginnen zu tanzen – sie können gar nicht anders.
C. P.: Ist es ein hoher Wert in Afrika, anderen Respekt zu erweisen?
M. A. Heppner: Das lebt noch ganz stark, vor allem Älteren gegenüber. Aber auch Frauen respektieren die Männer; bei einem Familientreffen beispielsweise werden die Männer beim Essen zuerst bedient. Durch diesen Respekt entsteht aber auch ein Abstand, und das schafft in den Familien Probleme mit der Kommunikation: Über Gefühle wird nicht gesprochen. Wenn ein junger Mann eine Freundin hat, darf er darüber nicht sprechen und darf sie den Eltern auch erst dann vorstellen, wenn er sie heiraten will.
man muss die Leute anschauen, sie in ihrer Sprache grüßen – dann lächeln sie
C. P.: Bist du im Township rumgelaufen?
M. A. Heppner: Man liest in den Zeitungen, dass Kapstadt eine der gefährlichsten Städte der Welt sei und die Townships gehören dazu. Alleine sollte man dort nicht herum laufen, so sagte man uns. Aber mit der Zeit bekommt man ein Gefühl, beispielsweise darf man keine Uhr, Schmuck oder sonstiges tragen, was teuer aussieht. Irgendwann bin ich dann doch allein dort gewesen, man muss die Leute anschauen, sie in ihrer Sprache grüßen – dann lächeln sie. Sie finden es gut, wenn ein Weißer in das Township kommt und zeigt, dass er keine Angst hat. Wenn wir überfallen wurden, war das außerhalb vom Township.
ein heftiger Überfall
C. P.: Wie wurdest du überfallen?
M. A. Heppner: Ein eher harmloser Überfall passierte mir, als mir jemand einen 10-Euro Schein aus der Hand riss.
Einen heftigen Überfall erlebte ich abends zuhause. Alle anderen waren ausgegangen, ich wollte an diesem Abend nicht mitgehen. Es hatte an der Außentür geklingelt. Generell hat man ein Gitter an der Holztür, aber ich war zu unvorsichtig, schaute nicht durch, sondern öffnete gleich die Tür. Die wurde sofort aufgeschmettert, prallte mir gegen die Stirn, jemand kam mit dem Messer rein. Ich versuchte es reflexartig abzuwehren, aber greife dabei in das Messer und schneide mir in die Hand. Es gibt einen kurzen Kampf, ich werde noch in den Arm geschnitten, renne in mein Zimmer, werde gestoßen, pralle gegen den Spiegel und liege dann am Boden. Zum ersten Mal hatte ich Angst, bleibend verletzt zu werden oder gar zu sterben. Ein weiterer Tritt folgte, dann Stille. Ich war unfähig, irgendetwas zu machen – das war deren Absicht.
Sie räumten die Schränke aus, nahmen alle Laptops mit. Als sie dann gegangen waren, war ich blutüberströmt.
Ich habe bei dem Nachbarn gegenüber geklingelt und etwas von Hilfe und „Please call the Police“ gestammelt. Als Antwort kam allerdings nur „I am not interested“. Boom! Und die Tür war wieder zu.
Die nächste Nachbarin rief die Security, reichte mir ein Handtuch und etwas Wasser, ließ mich aber dabei vor ihrem verschlossenen Gitter sitzen. Die hatten alle richtig Angst. Irgendwann kam die Polizei. Zwei Stunden später fuhr ein Krankenwagen an, um 12 oder 1 Uhr die Spurensicherung. Es ist ganz anders als in Deutschland. So richtig gute Unterstützung bekommt man nicht.
Das war ein Schock für mich, aber letztlich hat das an meiner Einstellung zu Südafrika nichts geändert. Mein Herz schlägt dort, zumindest zur einen Hälfte.
bei allen Gelegenheiten wird getanzt
C. P.: Was fandest du an Afrika toll?
M. A. Heppner: Zum einen ist es die Kultur im Township, wo ich auch oft die Wochenenden verbracht hatte. Das gemeinschaftliche Leben ist fantastisch, es ist viel mehr ein Geben und Teilen, viel mehr Verständnis füreinander, als ich es von Deutschland kenne. Und sie sind einfach ganz entspannt, einen hektischen Alltag kennen die nicht.
Abends, wenn man durch das Township geht, hört man an allen Ecken Musik, meistens Hip-Hop, und alle tanzen sie.
Musik spielt hier, egal für welches Alter, eine sehr große Rolle, dementsprechend auch der Tanz. Moderner Tanz, genauso wie traditioneller Tanz ist sogar im Kindergarten und der Schule vertreten. Auch in der Kirche, wenn im Fußballstation der Verein gewinnt, bei Hochzeiten – bei allen Gelegenheiten wird getanzt. Sie können sich perfekt im Rhythmus bewegen – als Weißer kommt man sich dagegen vor wie ein Storch.
Andererseits ist die Landschaft wunderschön. Einmal hatte ich im Ozean das tolle Erlebnis, auf 2-3 Meter Abstand neben einem Wal zu schwimmen.
Im Kindergarten ist mir vor allem ein Kind besonders ans Herz gewachsen. Ich hatte mit diesem Kind und der Mutter Unternehmungen gemacht; das war für sie erst befremdlich, weil sie das nicht ganz verstehen konnten. Aber nach einer Weile fühlte ich mich dort wie in meiner zweiten Familie. Zum Schluss hatte ich diesem Kind ein Trampolin geschenkt. Ich will sie auch weiterhin unterstützen, wenn sie etwas brauchen. Und natürlich möchte ich sie nach Möglichkeit auch wieder besuchen.
C. P.: Könnte man sagen, dass die Schwarzen besonders viel Wärme ausstrahlen?
M. A. Heppner: Das trifft zu. Man kann es durchaus so sehen, dass wir Weißen an ihrem Leid und ihrer Armut schuldig sind. Und trotzdem haben sie uns gegenüber keinen Hass. Wenn man als Weißer im Township ist, wollen sie einen gerne kennenlernen, sind nett und gehen gut mit einem um. Die wenigsten fragen, ob man Geld für sie hat. Sie wollen nichts haben, sondern mit dir etwas unternehmen. Sie wollen dir ihre Kultur zeigen: „Komm, wir gehen heute Abend tanzen“ oder „Probier mal afrikanisches Bier“. Sie teilen ganz viel und gerne: wenn sie Bier trinken oder Zigarette rauchen, geht das in der Runde rum. Sie leben in ihren Blechhütten und sind trotz ihrer Armut glücklich.
Natürlich gibt es Probleme: Alkohol und Drogen, sie essen ungesund, fettreich und haben Übergewicht. Aber wiederum auf der anderen Seite legen sie Wert auf gute Kleidung und pflegen ihr Äußeres.
er ist jetzt „Meister seines Lebens“ geworden
Auch streben sie nach dem, was wir in Europa haben, bzw. wie sie es im Fernsehen vermittelt bekommen: coole Autos, schöne Häuser und viel Geld. Aber sie bemühen sich nicht unbedingt um mehr Arbeit. Ich hatte einen Schwarzen kennengelernt, der zuerst Rechtsanwalt werden wollte; später sagte er mir dann, dass er jetzt „Meister seines Lebens“ geworden sei, er liebt sein Leben so wie es ist und Jura studieren bräuchte er jetzt nicht mehr.
C. P.: Was hast du für dich persönlich gelernt?
M. A. Heppner: Auf eigenen Füßen zu stehen. Das hatte man mir in Deutschland dann auch gesagt: „Anael, du bist aber erwachsen geworden.“
Auch das WG-Leben mit den anderen 7 bis 13 Freiwilligen war eine Herausforderung, miteinander klar zu kommen. In der Schule hatte ich über das Leben gelernt, aber mit dem Leben umgehen – das habe ich in Afrika gelernt.
Ich habe einen Lebensstil gefunden, und das entstand in mir durch die verschiedenen Erfahrungen: im Township leben, dann mit den anderen jungen Deutschen zusammen in einer großen WG, und irgendwann habe ich mir in einer Garage mein eigenes Zuhause gebaut. Auch habe ich die Impulse bekommen, mich immer mehr zu disziplinieren und immer am Ball zu bleiben, also weiter zu lernen. Als ich damals aus der Schule ging, dachte ich: „Nie wieder lernen!“ In Afrika aber habe ich mich über meine Fortschritte gefreut und wollte nicht mehr meine Zeit verplempern. Inzwischen habe ich das Bedürfnis, das Abitur nachzumachen, weil es durchaus brauchbar ist.
C. P.: Würdest du anderen jungen Menschen auch so ein Freiwilligendienst im Ausland empfehlen?
M. A. Heppner: Unbedingt empfehle ich es jungen Menschen, ihre Erfahrungen zu machen, bevor sie in die Berufswelt eintauchen. Aber keiner sollte dazu seinen angestrebten Schulabschluss abbrechen.
Es ist wichtig, sich selber kennen zu lernen, und dies tun wir, wenn wir an unsere Grenzen kommen. Und das kann man sehr gut im Ausland erleben.