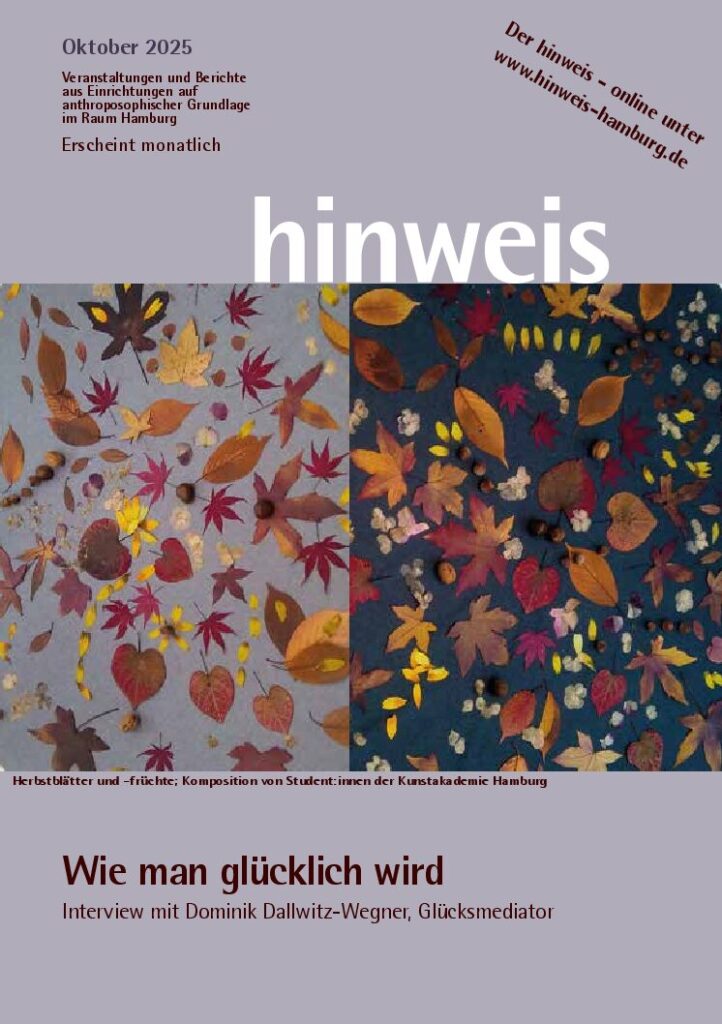Willkommen auf der Seite für Adressen, Veranstaltungen und Berichte aus Einrichtungen auf anthroposophischer Grundlage im Raum Hamburg
Buddhismus und Anthroposophie Teil II
Interview mit Steffen Hartmann, Anthroposoph und Oliver Petersen, Buddhist

 Wie stehen Buddhismus und Anthroposophie zueinander? Gibt es Parallelen? Betrachtet man den Buddhismus und die Anthroposophie in ihren spirituellen Grundlagen, lassen sich erstaunliche Beziehungen finden. In diesem zweiten Teil des Interviews geht es jeweils um die Geistesschulung und Meditation.
Wie stehen Buddhismus und Anthroposophie zueinander? Gibt es Parallelen? Betrachtet man den Buddhismus und die Anthroposophie in ihren spirituellen Grundlagen, lassen sich erstaunliche Beziehungen finden. In diesem zweiten Teil des Interviews geht es jeweils um die Geistesschulung und Meditation.
Interviewpartner: Oliver Petersen, geboren 1961, ist Übersetzer und leitet Studienkreise, Seminare und Meditationskurse. Er wurde 1980 Schüler von Geshe Thubten Ngawang und war 16 Jahre Mönch (1983-1999). Er ist Magister der Tibetologie, Religionswissenschaft und Philosophie. Er hat eine gestalttherapeutische Ausbildung und ist für das Tibetische Zentrum seit vielen Jahren im Interreligiösen Dialog und als Referent in der Öffentlichkeitsarbeit aktiv.
Steffen Hartmann, geboren 1976, ist Pianist, Autor und Dozent für Anthroposophie. Er leitet zusammen mit Torben Maiwald den anthroposophischen Verlag Edition Widar und arbeitet im Rudolf Steiner Haus Hamburg im Vorstand mit. Er geht einer internationalen Vortrags- und Konzerttätigkeit nach, außerdem leitet er Seminare zu anthroposophischer Meditation.
Christine Pflug: Was ist Geistesschulung, was ist Meditation? Welche Schritte gibt es?
Steffen Hartmann: Es sind im Grunde zwei Bereiche. Das eine ist die Meditation im engeren Sinne, und das andere ist sozusagen der Himmel oder die Landschaft, in der die Meditation stattfindet, d. h. die Arbeit an der Seele. Bei der Meditation im Sinne der Anthroposophie ist es so, dass man konzentriert an etwas baut.
Zum Beispiel die Rosenkreuz-Meditation, bei der man ein Kreuz visualisiert, oder sich selbst ins Kreuz stellt, und dann um den Kreuzungspunkt sieben Rosenblüten imaginiert.
Entscheidend ist, dass man dieses Bild in sich leben lässt, es gleichzeitig durch Gedanken und Gefühle anreichert und versucht, darauf zu ruhen. Und ich kenne es so, wenn es überhaupt erstmal gelingt, dass es vor einem steht, man irgendwann wie hineinschlüpft und selber Kreuz oder Rose wird, bis dahin, dass man vielleicht sogar die Rosen duftend erlebt oder dass sie ihre Farbe verändern. Es kann lebendig werden. Der nächste wichtige Schritt ist, dass man nicht bei dem Bild stehen bleibt, sondern in die Stille geht, also das, was man aufgebaut hat, nochmal wie auslöscht.
Dieses, was ich mir zunächst aufbaue, könnte man auch als eine subjektive Imagination bezeichnen. Ich gebe ja etwas von mir da hinein. Und bei diesem nächsten Schritt, wenn ich das auslösche, werde ich mehr zu einem Gefäß, wo das eigentlich Geistige, das über meinen subjektiven Geist hinausgeht, einströmen kann. Man könnte Meditation auch so beschreiben: Ich versuche ein Gefäß zu werden für das Geistige, das in mich einströmt.
Und was mir immer wichtiger wird: Wenn man bei Rudolf Steiner schaut, wie er das aufbaut, findet er oft ganz einfache Übungen sehr wesentlich. In dem Buch „Theosophie“ beschreibt er gar keine Meditation, sondern Tugenden, die man entwickeln soll, z. B. innere Ruhe, Geduld, Gelassenheit, Positivität ausbilden, also im Grunde ganz grundlegende Haltungen der Seele.
Ich glaube, dass diese Ohnmacht und das Scheitern das eigentliche Nadelöhr zur geistigen Welt sind.
Und ich erlebe das immer stärker so, dass es diese Übungen sind, mit denen man eigentlich nie an ein Ende kommt. Gerade wenn man konsequent versucht, das zu üben, erlebt man immer stärker das, was man daran noch nicht kann. Ich glaube, das ist sogar Teil des geistigen Fortschritts, dass man dieses Ungenügen an sich selbst erfährt und ein Stück weit einfach aushält. Und das ist für mich auch eine Möglichkeit, dass diese Anhaftungen oder falsche Identifikationen abfallen. Es ist eigentlich das Erlebnis von Ohnmacht oder Scheitern, und ich glaube, dass diese Ohnmacht und das Scheitern das eigentliche Nadelöhr zur geistigen Welt sind.
S. Hartmann: In dem Buch „Wie erlangt man Erkenntnisse der höheren Welten?“ gibt es die Stufen Vorbereitung, Erleuchtung und Einweihung. Danach kommt ein Kapitel, das ich sehr wichtig finde, das heißt einfach „Praktische Gesichtspunkte“. Man denkt „Jetzt bin ich doch schon bei der Einweihung“, und da spricht er über solche Dinge, wie man beispielsweise lernen soll, wenn man beleidigt wird, dass die Beleidigung einen nicht trifft; oder wenn der Zorn kommt, dass man nicht in die Identifikation mit dem Zorn geht. Oder man soll die Furchtsamkeit, den Aberglauben, unnötige Mitteilungssucht und andere ganz grundlegende Dinge überwinden. Das ist für mich so typisch für Rudolf Steiner, dass er da, wo man denkt „Jetzt bin ich doch schon sehr weit“ mit so ganz grundlegenden Dingen anfängt.
Ich finde es auch ein wenig humorvoll, dass Rudolf Steiner am Ende seines Lebens eine erste Klasse gründet, für die am weitesten fortgeschrittenen Schüler. Da ist auch diese Geste: das ist nicht das Abitur, sondern wir gehen jetzt in die erste Klasse (der freien Hochschule für Geisteswissenschaft).
„Den Dingen geht der Geist voran, der Geist entscheidet.“
C. P.: Herr Petersen: Bekannt ist die Zen-Meditation. Welche Geistesschulungen gibt es noch im Buddhismus?
O. Petersen: Ganz allgemein ist die Geistesschulung im Buddhismus sehr wichtig. Der Buddha sagt im Dhammapada, einer wichtige Schrift für alle Traditionen: „Den Dingen geht der Geist voran, der Geist entscheidet.“ Und „Glück und Leid gehen letztlich auf den Zustand unseres Geistes zurück.“
In den vier „Edlen Wahrheiten“ geht es um Leid und seine Ursache und Glück und seine Ursache. Die Ursache des Leidens ist Hass, Gier und Unwissenheit, und der Weg zum Glück ist die Überwindung von Hass, Gier und Unwissenheit. Und alles, was im Buddha Dharma gelehrt wird, dient der praktischen Schulung der Überwindung. Es geht darum, Heilsames zu entwickeln oder Tugendhaftes – das ist letztlich das gleiche.
Es gibt zahllose Einteilungen, aber eine ist die der drei höheren Schulungen. Da geht es um Ethik, Konzentration und Weisheit.
Wenn man sich ethisch verhält, dann kann man in die innere Schulung eintreten.
Der Beginn der geistigen Schulung ist, dass man im praktischen Verhalten nicht Dinge macht, die völlig im Widerspruch zur geistigen Schulung stehen. Die Ethik begrenzt erstmal das Verhalten, beispielsweise wie nicht töten, nicht stehlen, nicht lügen, kein sexuelles Fehlverhalten usw. Und noch besser ist es, wenn man anderen Menschen praktisch hilft. Und wenn man sich ethisch verhält, dann kann man in die innere Schulung eintreten. Meditation heißt auch Pflege des Geistes; man könnte auch sagen Gewöhnung oder vertraut machen; man macht sich vertraut mit Tugenden oder heilsamen Eigenschaften, wie auch Rudolf Steiner das lehrt. Alles worum es geht ist, dass man wünschenswerte Geisteszustände anwachsen lässt und nicht so Wünschenswertes beseitigt. Du versuchst dein Geist zum Positiven zu entwickeln. Und dafür musst du deine Rede auf jeden Fall erstmal in positive Richtung gestalten. Dazu gehören grobe Rede, Zwietracht säen, Lügen, sinnlose Rede etc. Auch wenn man es innerlich manchmal macht, es äußerlich wenigstens nicht ausleben.
Viele Buddhisten auf der Welt halten sich erstmal an die Ethik und sind gar nicht groß auf einem meditativen Weg.
Auf jeden Fall wird durch die Ethik technisch gesehen die sogenannte grobe Erregung des Geistes verringert. Das heißt, das Leben wird ein bisschen friedlicher und angenehmer. Übrigens auch politisch. Wir setzen uns für Frieden und die Erhaltung der Schöpfung ein, damit wir Umstände haben, um uns überhaupt entwickeln zu können.
konzentrative und analytische Meditation
Und dann beginnt der eigentliche meditative Schulungsweg. Dieser unterscheidet sich in konzentrative und analytische Meditation. Bei der Konzentration lernt man, dass der Geist nicht nur ruhig wird, sondern vollkommen einspitzig – er konzentriert sich nur noch auf eine Sache. Das nennt man Shamatha. Beispielsweise kann man einen Buddha visualisieren und bleibt dann geistig einfach bei der Wahrnehmung des Buddhas. Man kann auch eine Rose nehmen oder eine Lotusblume. Es gibt viele Objekte, aber es sollte ein attraktives und spirituelles Objekt sein. Man richtet sich geistig darauf und versucht, immer wieder die Ablenkung zu bemerken und wieder zurückzugehen. Bis man sich daran gewöhnt hat. Der Geist ist aus buddhistischer Sicht gewöhnungsfähig, genauso wie der Körper sich an Dinge gewöhnt. Der Geist ist sogar schrankenlos gewohnheitsfähig, bis hin zur Buddhaschaft. Auf jeden Fall kann man sich daran gewöhnen, immer konzentrierter zu werden.
C. P.: Was gibt es noch außer der Konzentration?
O. Petersen: Konzentration, so hat der Buddha eindeutig gesagt, ist nicht die Befreiung. Der Geist wird nur zeitweilig ruhig, aber die inneren Anlagen der Unwissenheit und Verwirrung sind noch da. Wenn du die Konzentration wieder verlässt, kommen sie potentiell wieder.
konzeptuelle Erkenntnis der Realität mit tiefer Konzentration verbinden
Das letztliche Gegenmittel gegen die Unwissenheit ist Weisheit. Und dafür muss man durchaus analysieren und auch philosophieren. Man verbindet die konzeptuelle Erkenntnis der Realität mit tiefer Konzentration. Dadurch erreichst du einen überrationalen oder überkonzeptuellen Zustand unmittelbarer geistiger Erfahrungen.
Aber Analysen beziehen sich nicht nur auf die letztliche Realität, sondern alle Tugenden, außer der Konzentration, werden mithilfe von Analysen hervorgebracht. Das ist im Westen gar nicht so bekannt. Die meisten denken bei buddhistischer Meditation nur an Ruhe und Atembetrachtung. Aber wenn der Geist zur Ruhe gebracht worden ist, dann geht es erst richtig los. Dann analysierst du zum Beispiel die Freundlichkeit der Wesen oder wie nah sie dir stehen und kommst zu der Erkenntnis, dass Liebe und Mitgefühl die richtige Einstellung wären. Und dann versuchst du das auch in dir hervorzubringen und konzentrierst dich dann abschließend auf diesen Zustand von Mitgefühl, den nennt man „Liebende Güte“ (= Pali Metta, im Sanskrit Maitri).
Nach dieser Vorgehensweise übt man auch Geduld, Genügsamkeit, Vertrauen. Es gibt zahllose Tugenden und Aufteilungen im Buddhismus.Sie werden aber alle nach dem gleichen Verfahren entwickelt, dass du auf der Grundlage eines ethischen Lebens in der Meditation versuchst, auf der Basis guter Lehren und Schriften, die es reichlich gibt, bestimmte Analysen anzustellen, wie die Dinge eigentlich sind und wie sie nicht sind. Zum Beispiel, was gerade gesagt wurde, dass man nicht auf Ärger mit Ärger reagiert. Da gibt es Texte, die nennt man Lojong im Tibetischen. Das heißt, dass man auf Schwierigkeiten positiv reagiert. Man nimmt die Herausforderungen an. Das ist gerade so ein spirituelles Futter, dass man Schwierigkeiten in den Pfad zur Erleuchtung umwandelt. Man versucht sich deutlich zu machen, dass schwierige Menschen für einen selber hilfreich sein können, um sich weiterzuentwickeln. Mein Ziel ist spirituelle Entwicklung und die kann ich nur erreichen, wenn mich Leute auch mit Schwierigkeiten konfrontieren. Deshalb sind sie eigentlich ein Schatz für mich. Das ist sicherlich auch sehr christlich. Ich würde sagen, Jesus ist ein großer Lojong-Meister. Aber ich denke, in allen tieferen Traditionen wird letztlich erkannt, dass man gerade Schwierigkeiten benutzt, um sich besonders weiterzuentwickeln. Dafür musst du aber sehr gründlich analysieren und du musst natürlich auch über die Situation des Anderen nachdenken. Vergebung spielt auch eine große Rolle in solchen Dingen.
Letztlich ist die Analyse der Realität das beste Mittel, weil das alle Leidenschaften zerstört. Durch Geduld und Liebe werden die Leidenschaften nur verringert und nicht vollständig zerstört. Das kann aus buddhistischer Sicht nur die Weisheit.
C. P.: Man spricht heute immer wieder von der Achtsamkeit, die auch aus dem Buddhismus stammt. Welche Rolle spielt die?
die grundlegende Eigenschaft der Achtsamkeit
O. Petersen: Für alle drei Aspekte Ethik, Konzentration und Weisheit, die zusammengehören, braucht man die grundlegende Eigenschaft der Achtsamkeit; wir nennen sie Vergegenwärtigung oder Satipatthana. Das bedeutet, bei dem zu bleiben, womit du dich beschäftigst, d. h. du musst dich immer beobachten. Das sind eigentlich zwei Faktoren: Selbstbeobachtung und Vergegenwärtigung.
Für die Ethik brauchst du Vergegenwärtigung. Dir einfach vorzunehmen, ein guter Mensch zu sein, ohne zu achten, was du tust, ist sinnlos.
Bei der Konzentration brauchst du extreme Vergegenwärtigung. Wenn du dich auf ein Konzentrationsobjekt richtest, wird als erstes passieren, dass dein Geist abwandert; gerade heutzutage, wo wir so extrem unkonzentriert sind. Dann musst du wiederum dich selbst beobachten.
Der Buddha nennt die Vergegenwärtigung „den einzigen Weg“. Das bedeutet nicht, dass jeder Buddhist werden muss, aber es gibt keinen Fortschritt, auch nicht in einer weltlichen Aktivität, wenn man nicht lernt, bei der Sache zu bleiben.
Der ganze Weg besteht aus Ethik, Konzentration und Weisheit, aber du kannst keinen dieser Teile gehen, wenn du nicht übst, bei der Sache zu bleiben. Und da hat der Buddha uns ganz einfache und praktische Methoden gegeben. Er hat gesagt, bleib einfach beim Körper, bleib beim Gehen, bleib beim Atmen. Wenn du es schaffst, beim Atmen zu bleiben, dann hast du gelernt, wie du bei einer Sache bleibst. Aber das ist erst der Anfang, dann kannst du später deine Aufmerksamkeitsfähigkeit auf die philosophischen Inhalte genauso ausrichten.
Das ist heute auch säkular wieder sehr virulent, auch in der Psychotherapie, dass man lernt, seinen Geist zu beobachten und nicht abzuwandern. Und das gibt einem schon eine große Erholung von all den inneren Verwirrungen, die man hat.
C. P.: Steffen, Rudolf Steiner spricht beim Schulungsweg vom achtgliedrigen Pfad des Buddha. Was versteht man darunter?
der achtgliedrige Pfad des Buddha bei Rudolf Steiner
S. Hartmann: Ich beschreibe einfach, wie ich persönlich damit lebe. Die erste Übung ist das rechte Vorstellen. Das würde ich mit der Sonne in Verbindung bringen: Das Licht der Sonne, das auf die Dinge fällt und mir die Wirklichkeit zeigt, wie sie ist.
Und schon diese Übung ist ja unendlich schwer. Wenn man an politische oder auch an wissenschaftliche Themen denkt – wie bilde ich mir ein wirklichkeitsgemäßes Urteil? Es ist eine riesen Anforderung, dass ich überhaupt meinen Geist darauf ausrichte, das Rechte, das Wahre vorzustellen. Und für mich gehört zu dieser Übung auch, dass ich mir gegebenenfalls sage: Ich weiß es nicht, ich lasse es offen.
im richtigen Moment auch mal sagen, dass ich es nicht weiß
Es gibt so viele Verschwörungstheorien oder überhaupt Theorien, die die ganze Welt erklären. Und da gehört für mich bei diesem ersten Schritt vom achtgliedrigen Pfad dazu, im richtigen Moment auch mal zu sagen, dass ich es nicht weiß.
Das Zweite hat für mich dann mit dem Mond zu tun. Das ist der rechte Entschluss. So wie der Mond das Sonnenlicht reflektiert, versucht man zuerst, das Wahre vorzustellen und dann auch zu rechten Entschlüssen zu kommen und mit dieser Kraft ins Handeln zu gehen.
Das Dritte hat für mich mit dem Mars zu tun. Das ist das rechte Sprechen und Schweigen, also diese Wortkraft, die mit dem Mars zusammenhängt, beherrschen zu lernen. Man kann ja durch das Wort auch unendlich verwunden. Es geht darum, in dem Was und im Wie so zu sprechen, dass es sich auf eine gute Weise einfühlt in die Welt – und im richtigen Moment auch mal schweigen.
Bei der vierten Übung sehe ich einen starken Bezug zum Merkur: die rechte Tat. Ich habe das für mich so genannt, dass man Karma-Bewusstsein ausbildet: Was sind die Folgen einer Handlung? Wie wirken meine Handlungen weiter in der Welt? Und das möge heilsam sein.
Der Merkur ist ja auch der Vermittler. Es geht also darum, dass ich die Dinge so tue, dass sie möglichst auf eine gute Weise weiterwirken.
Diese ersten vier Übungen sind für mich eigentlich schon praktizierte „Philosophie der Freiheit“. Vom Erkenntnispunkt bis zum Handlungspunkt hat man vier Schritte, wo man immer wieder neu ansetzen kann, im Kleinen wie im Großen, das mit Bewusstsein zu durchleuchten.
Und dann kommt wie eine Schwelle bei der fünften Übung, es weitet sich nochmal. Das ist das rechte Maß. Das hat viel für mich zu tun mit dem Jupiter oder mit der wirklichen Weisheit. Mit Aristoteles könnte man auch sagen, dass ich immer wieder versuche, die Mitte zu finden zwischen den Extremen. Es ist eine Waage-Übung, eine Balance-Übung.
Und das sechste ist das rechte Streben. Das verbinde ich mit der Liebekraft von der Venus. Also eigentlich die Liebe zu den Idealen, dass ich mir Ziele setze, die ich liebe und aus Liebe ihnen folge. Und aufgrund der Liebekraft dann auch das Scheitern in Kauf nehme oder aushalte und trotzdem dranbleibe.
Das hat für mich mit diesem rechten Streben zu tun. Aber da brauche ich zum Beispiel auch das rechte Maß. Sonst, wenn ich zu perfektionistisch werde, zu sehr mich festbeiße, dann könnte das Streben auch kippen. So greifen die verschiedenen Übungen ineinander und korrigieren sich gegenseitig.
Die siebte ist dann das rechte Gedächtnis. Das bringe ich mit dem Saturn in Zusammenhang, dass man zurückschaut auf das, was man an einem Tag, in einer Woche, in einem Jahr getan hat. Es gibt ganz viele Übungen in der Anthroposophie, wo wir die Rückschau üben. Man lernt aus dem, was man getan hat, was einem widerfahren ist und auch, was aus dem Schicksal auf einen zukam. Aus dem heraus kann man neu und anders in die Zukunft gehen.
So hat man die sieben Planeten, von der Sonne bis zum Saturn.
Und die achte Übung, die rechte Beschaulichkeit, würde ich mit der Erde als solcher in Verbindung bringen. Ich kann nur im inkarnierten Zustand als Erdenmensch auf mich schauen. Rudolf Steiner sagt, man soll lernen, auf sich zu blicken wie auf einen Fremden. Das hat für mich auch mit dieser rechten Beschaulichkeit zu tun. Ich schaue mir das, was ich mit den sieben anderen Übungen versuche, an und prüfe mich auch immer wieder. Das ist quasi die Übung, die während der ganzen Woche immer mitläuft.
Ich will noch hinzufügen, dass die klassische Zuordnung von Rudolf Steiner zu den Wochentagen bzw. Planeten etwas anders ist, da würde man mit dem Samstag (Saturn) beginnen; das hier Beschriebene beruht auf meinen eigenen Üb-Erfahrungen.
Meine persönliche Erfahrung ist: Diese acht Übungen sind so angelegt, dass man mit ihnen nie an ein Ende kommt, und je länger man sich damit beschäftigt, umso stärker wird das besagte Scheitern erlebbar.
Und das begeistert mich so, dass da Buddhismus, Christentum und Anthroposophie sich verbinden.
Und gleichzeitig sind diese acht Übungen ein Organismus – und das begeistert mich so – , den der Buddha schon 600 v. Chr. als Weg ins Nirwana gelehrt hat. Rudolf Steiner greift das auf und für mein Empfinden verchristlicht er es.
Mit diesen Übungen kann man ein erdentauglicher, ein Erd-zugewandter, ein dem Christus nachfolgender Mensch werden. Und das begeistert mich so, dass da Buddhismus, Christentum und Anthroposophie sich verbinden.
Und vielleicht darf ich als Abschluss noch einen Satz von Rudolf Steiner lesen, den ich mitgebracht habe: „Der im Liebesfeuer sich hinopfernde Buddha ist der Inspirator unserer Geisteswissenschaft.“ (aus GA 130)